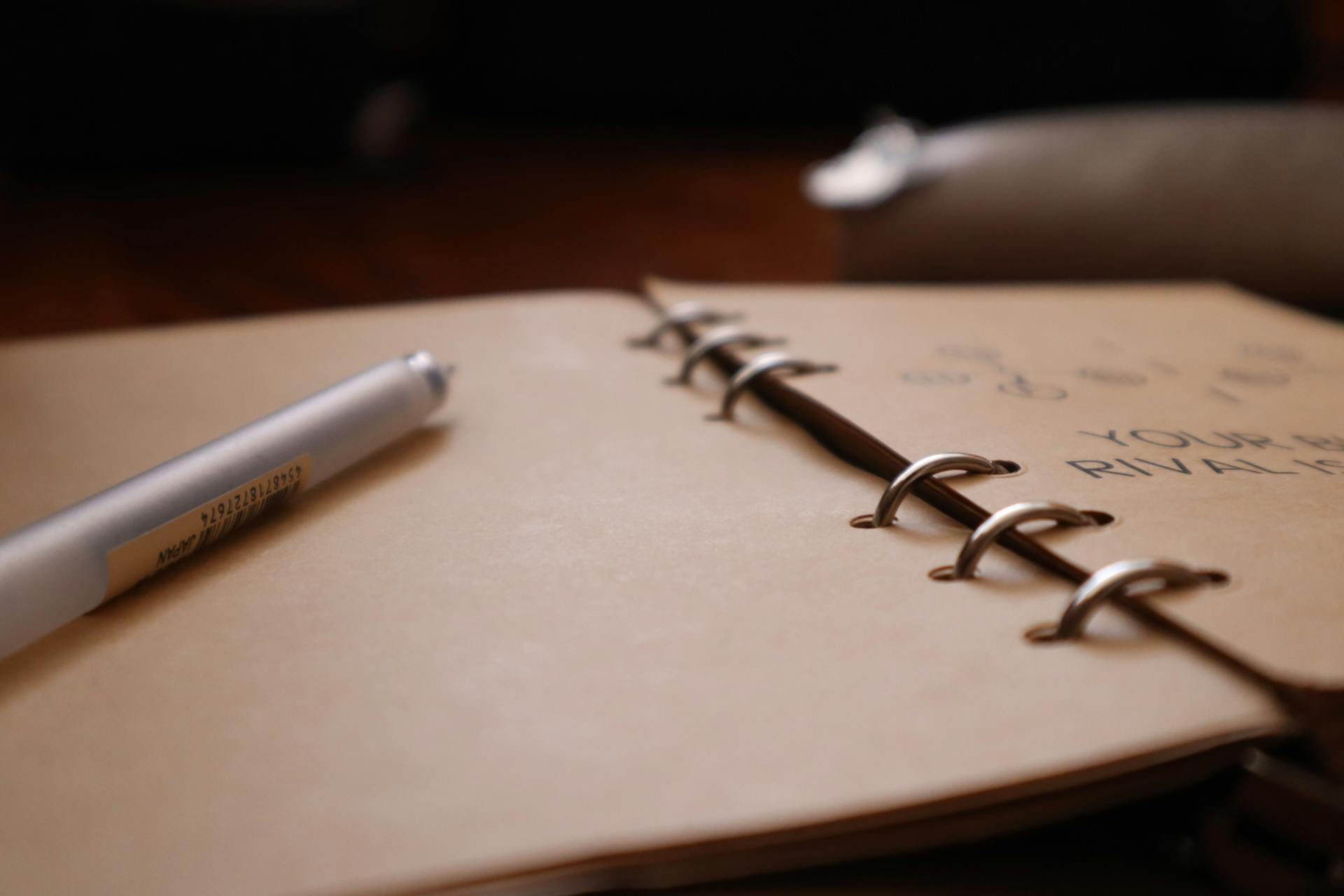Unternehmenskultur als Nährboden: Wie Führungskräfteentwicklung wirklich gelingt

Stellen Sie sich vor, Sie haben die widerstandsfähigsten Samen für die prächtigsten Pflanzen erworben. Voller Vorfreude pflanzen Sie diese in Ihren Garten. Doch der Boden ist steinig, nährstoffarm und wird kaum bewässert. Was wird passieren? Selbst die besten Samen werden nicht aufgehen. Sie verkümmern, bevor sie überhaupt die Chance hatten, Wurzeln zu schlagen.
Genau dieses Bild lässt sich auf die Führungskräfteentwicklung in Unternehmen übertragen. Viele Organisationen investieren hohe Summen in exzellente Führungstrainings und Coachings (die Samen), wundern sich dann aber, warum sich in der Praxis so wenig ändert. Der Grund ist oft derselbe: Der Nährboden – die Unternehmenskultur – ist nicht bereit für die neuen Verhaltensweisen, die dort wachsen sollen. Wenn ein Leadership Development Program auf eine Kultur trifft, die die gelehrten Prinzipien nicht unterstützt, ist die Investition zum Scheitern verurteilt.
Unternehmenskultur: Das unsichtbare Betriebssystem Ihrer Organisation
Was genau ist die Unternehmenskultur? Es ist nicht der Obstkorb, der Kicker im Pausenraum oder das perfekt designte Werte-Poster an der Wand. Kultur ist das, was der renommierte Organisationspsychologe Edgar Schein als die „tiefen, grundlegenden Annahmen“ einer Organisation beschrieb. Es sind die ungeschriebenen Regeln, die das Verhalten der Mitarbeitenden steuern, wenn niemand zusieht. Es ist „die Art und Weise, wie wir die Dinge hier tun.“
Schein unterteilt die Kultur in drei Ebenen (PsychSafety, 2023):
- Artefakte (sichtbar): Die Architektur des Büros, der Dresscode, die Sprache.
- Bekundete Werte (hörbar): Die offiziellen Leitsätze und Unternehmenswerte, z. B. „Innovation“ oder „Teamgeist“.
- Grundlegende Annahmen (unsichtbar, aber mächtig): Die unbewussten Überzeugungen, die das tatsächliche Verhalten steuern. Zum Beispiel kann der bekundete Wert „Innovation“ von der grundlegenden Annahme „Fehler machen ist karriereschädlich“ komplett untergraben werden.
Ein Führungstraining, das agiles Arbeiten und Risikobereitschaft lehrt, prallt an einer solchen Kultur der Fehlervermeidung wirkungslos ab. Die soziale Norm ist stärker als jedes Seminar.
Die Wechselwirkung: Wie Kultur und Führung sich gegenseitig formen
Unternehmenskultur und Führungskräfteentwicklung stehen in einer dynamischen Beziehung. Sie sind keine getrennten Silos, sondern beeinflussen sich permanent gegenseitig.
1. Kultur definiert, was als „gute Führung“ gilt
In einer stark hierarchischen Kultur wird eine Führungskraft als „effektiv“ wahrgenommen, wenn sie entscheidungsstark ist und klare Anweisungen gibt. In einer agilen Netzwerkorganisation hingegen wird eine Führungskraft geschätzt, die ihr Team befähigt, coacht und Entscheidungen dezentralisiert. Ein Leadership Development Program muss daher immer mit der gewünschten Zielkultur abgestimmt sein. Es nützt nichts, partizipative Führung zu lehren, wenn im Alltag nur autoritäres Verhalten belohnt und befördert wird.
2. Kultur beeinflusst die Lernbereitschaft
Die Stanford-Psychologin Carol Dweck hat mit ihrer Forschung zum “Mindset” (Stanford Alumni, 2015) gezeigt, dass die Einstellung zum Lernen entscheidend für den Erfolg ist.
- Ein „Fixed Mindset“ geht davon aus, dass Fähigkeiten angeboren sind. In einer solchen Kultur wird das Eingeständnis, etwas nicht zu wissen oder Hilfe zu benötigen, als Schwäche angesehen. Führungskräfte haben Angst, ihr Gesicht zu verlieren.
- Ein „Growth Mindset“ geht davon aus, dass Fähigkeiten durch Anstrengung und Lernen entwickelt werden können. In einer solchen Kultur werden Herausforderungen und sogar Fehler als Lernchancen begriffen.
Eine Führungskräfteentwicklung kann nur in einer Kultur des „Growth Mindset“ wirklich gedeihen, in der Lernen und persönliche Weiterentwicklung aktiv gefördert und als Stärke angesehen werden.

3. Führungskräfte sind die entscheidenden Kulturträger
Führungskräfte haben eine überproportionale Wirkung auf die Kultur. Ihr tägliches Verhalten – was sie loben, was sie tolerieren, wie sie auf Fehler reagieren – wird von ihren Teams genau beobachtet und als Maßstab für akzeptables Verhalten interpretiert. Genau deshalb ist die Führungskräfteentwicklung der stärkste Hebel, um eine Unternehmenskultur gezielt zu verändern.
Die Strategie: Kultur und Entwicklung bewusst aufeinander abstimmen
Um die Falle des wirkungslosen Trainings zu umgehen, bedarf es eines strategischen Vorgehens:
- Kultur-Analyse: Führen Sie eine ehrliche Bestandsaufnahme durch. Welche Verhaltensweisen werden in Ihrer Organisation tatsächlich belohnt? Welche ungeschriebenen Regeln existieren?
- Zielkultur definieren: Leiten Sie aus Ihrer Unternehmensstrategie ab, welche Führungskompetenzen und kulturellen Merkmale Sie in Zukunft benötigen, um erfolgreich zu sein.
- Programm-Design: Gestalten Sie Ihr Leadership Development Program so, dass es gezielt die Verhaltensweisen der Zielkultur vermittelt und trainiert.
- Systemische Verankerung: Passen Sie die umliegenden Systeme an. Wenn Sie Teamarbeit fördern wollen, brauchen Sie teambasierte Arbeitsformate (etwa Workshops). Wenn Sie eine offene Feedbackkultur wollen, muss dies im Performance Management verankert werden.

Ein Szenario aus der Praxis
Ein mittelständisches Technologieunternehmen möchte den Sprung vom reaktiven Dienstleister zum proaktiven Innovator schaffen. Bisher war die Unternehmenskultur stark von Kontrolle und Perfektionismus geprägt; Fehler wurden sanktioniert. Ein früheres Kreativitäts-Führungstraining scheiterte kläglich.
Nun wird ein neues, integriertes Programm mit Coaching aufgelegt. Statt nur Kreativitätstechniken zu lehren, konzentriert sich das Coaching auf ganz konkrete Verhaltensanker für die Führungskräfte:
- Fehler als Lerndaten behandeln: In den Coaching-Sitzungen üben die Manager, wie sie auf Fehler im Team neugierig statt bestrafend reagieren können.
- Psychologische Sicherheit schaffen: Die Führungskräfte lernen, aktiv um abweichende Meinungen zu bitten und Raum für Experimente zu schaffen.
- Parallel dazu wird ein „Learning of the Month“-Award eingeführt, bei dem das Team prämiert wird, das aus einem gescheiterten Experiment am meisten gelernt hat.
Durch diese Kombination aus individuellem Coaching und einer Anpassung der organisationalen Rituale beginnt sich die Kultur langsam zu wandeln. Die Führungskräfteentwicklung wird so zum Motor der strategischen Transformation.
Fazit: Ohne den richtigen Nährboden keine Ernte
Führungskräfteentwicklung im luftleeren Raum ist eine verpasste Chance. Sie entfaltet ihre volle Kraft erst dann, wenn sie als integraler Bestandteil der Kulturentwicklung verstanden wird. Die Unternehmenskultur legt die Spielregeln fest, nach denen im Unternehmen agiert wird. Ein gutes Leadership Development Program gibt den Führungskräften die Werkzeuge an die Hand, um innerhalb dieser Regeln erfolgreich zu sein – oder, noch besser, um diese Regeln aktiv zum Positiven zu gestalten. Wenn Saat und Nährboden aufeinander abgestimmt sind, ist nachhaltiges Wachstum nicht nur möglich, sondern unausweichlich.
Möchten Sie analysieren, wie Ihre Unternehmenskultur und Ihre Führungskräfteentwicklung optimal ineinandergreifen können? Kontaktieren Sie uns noch heute.
FAQ
Ja, Executive Coaching spielt eine entscheidende Rolle bei der nachhaltigen Bindung von Führungskräften, indem es ihnen Raum zum Nachdenken, Wachsen und zielgerichteten Führen bietet. Durch individuelle Unterstützung stärken Führungskräfte ihre Kommunikation, ihre Entscheidungsprozesse und ihre Resilienz – drei wichtige Faktoren, um ihre Bindung und langfristige Zufriedenheit zu fördern.
Mit CoachHub Executive™ schaffen Unternehmen nicht nur die Grundlage für eine verbesserte Führungsleistung, sondern auch für eine stärkere Ausrichtung an den Unternehmenszielen, mehr Motivation und ein stärkeres Selbstvertrauen bei ihren Top-Talenten. All das trägt zu einer höheren Mitarbeiterbindung bei und sorgt für mehr Nachwuchs auf der Führungsebene.
CoachHub Executive™ geht weit über die einzelnen Sessions hinaus: CoachHub integriert Technologie, messbare Erkenntnisse und kontinuierliches Lernen gezielt in jede Coaching-Reise. Den Führungskräften bietet das Programm zahlreiche Vorteile – vom persönlichen Matching mit zertifizierten Coaches bis hin zu flexiblen Session-Formaten, um die persönliche Weiterentwicklung zwischen den Sessions zu fördern.
Herkömmliche Coaching-Programme sehen meist keine ausreichende Skalierbarkeit und keine messbare Nachverfolgung vor. CoachHub stellt dagegen sicher, dass die Erfolge durch datengesteuerte Dashboards auch gesehen werden. Außerdem sorgt die flexible Terminplanung rund um die Uhr für ein durchwegs hochqualitatives Coaching-Erlebnis für Führungskräfte weltweit, das gleichzeitig auf konkrete Unternehmensziele zugeschnitten werden kann.
Ja, Executive Coaching wird in 90 Ländern und in mehr als 40 Sprachen angeboten. Die lokalen Coach-Netzwerke sind genau auf die kulturellen und geschäftlichen Anforderungen internationaler Unternehmen zugeschnitten.




.svg)


.svg)





.png)